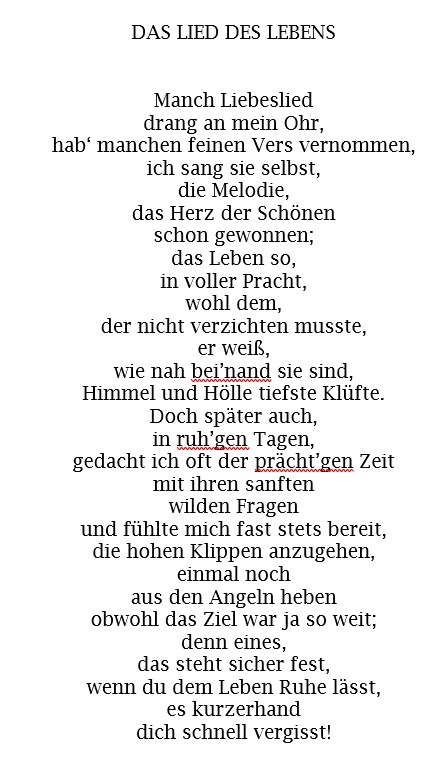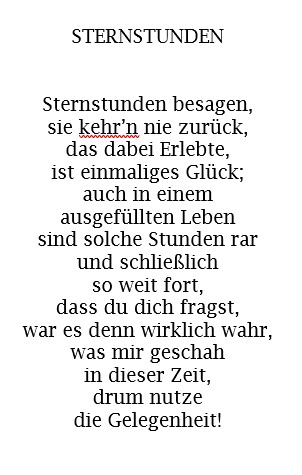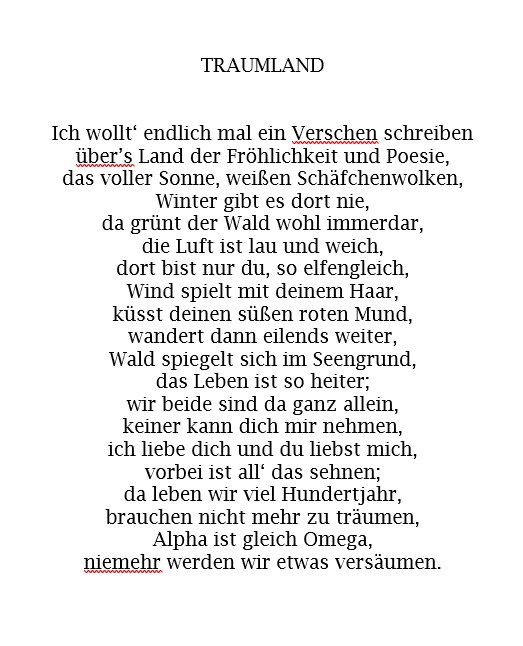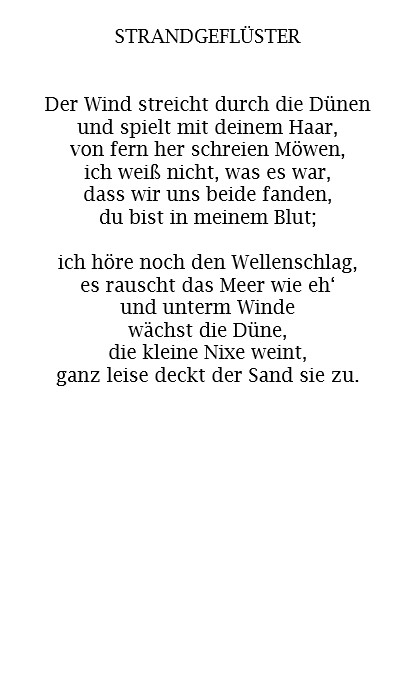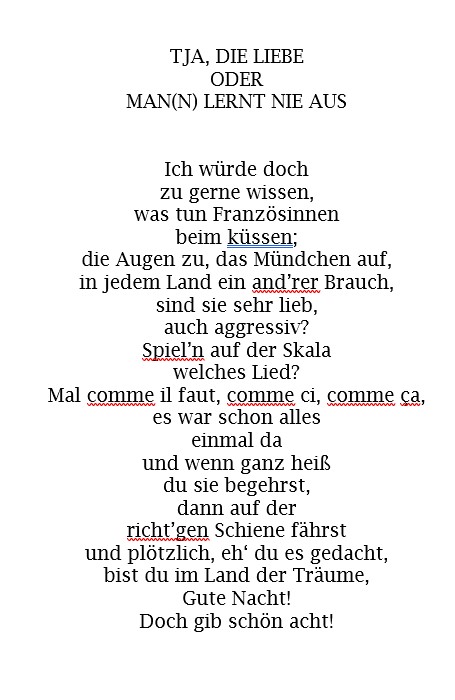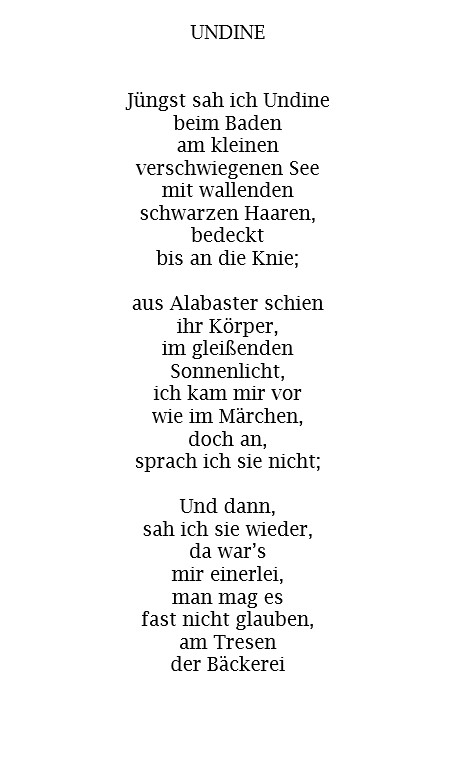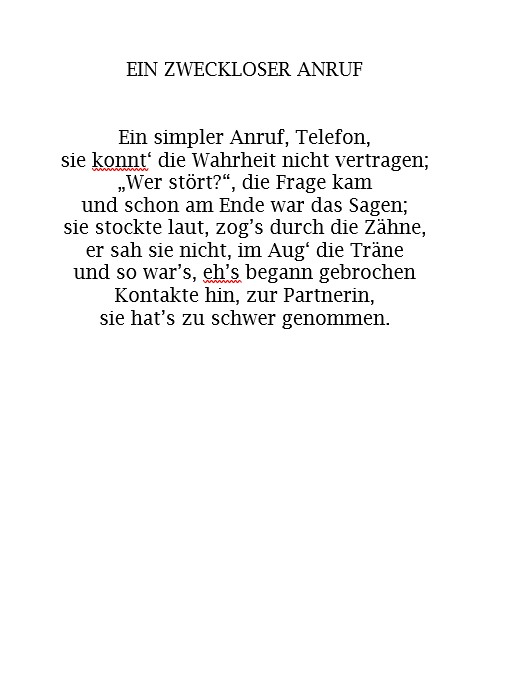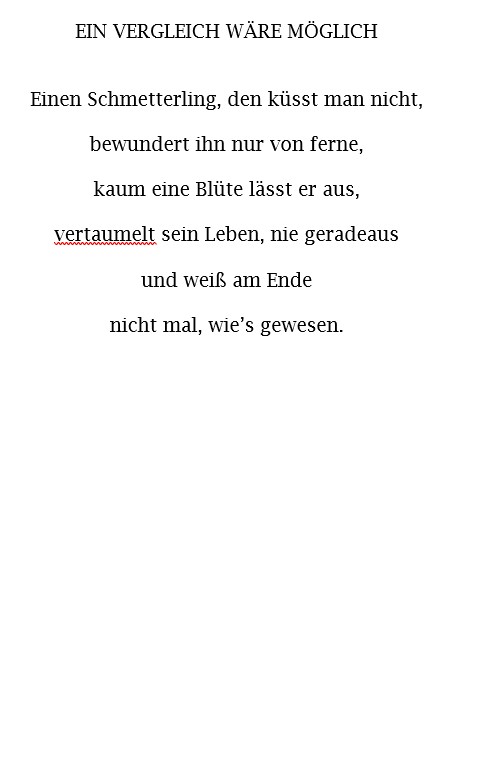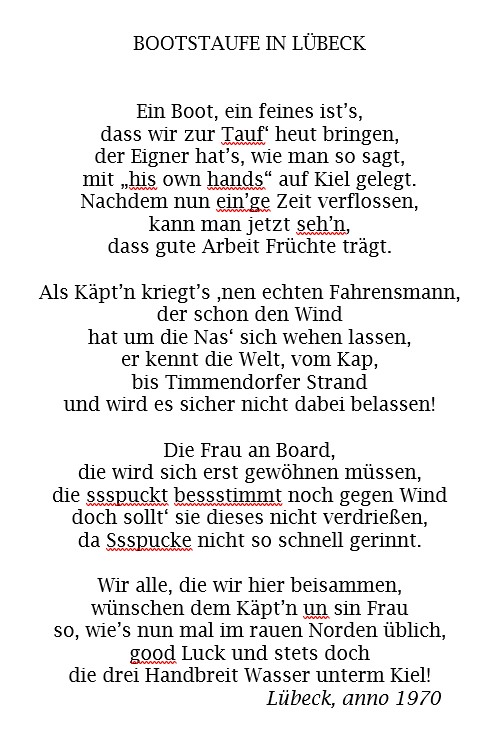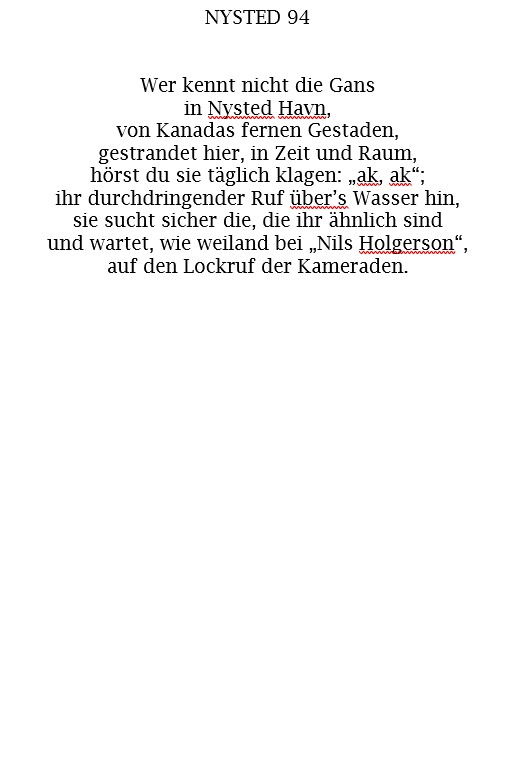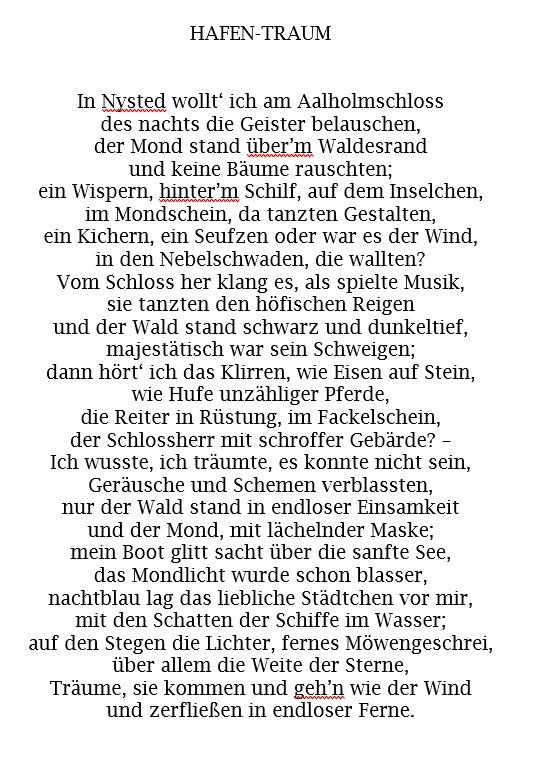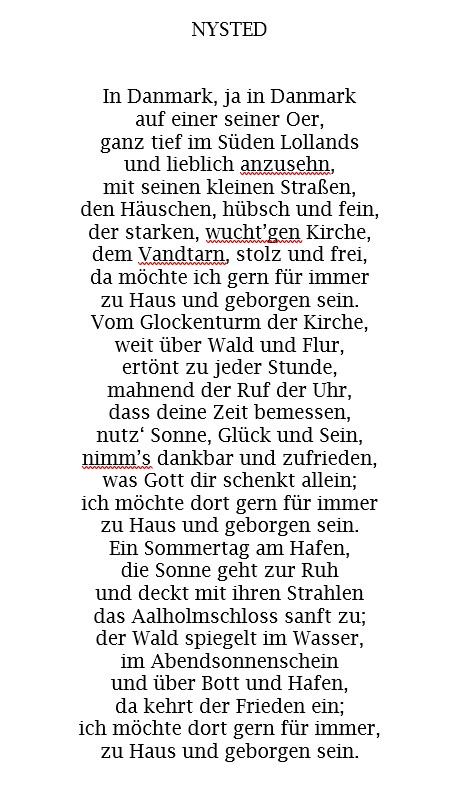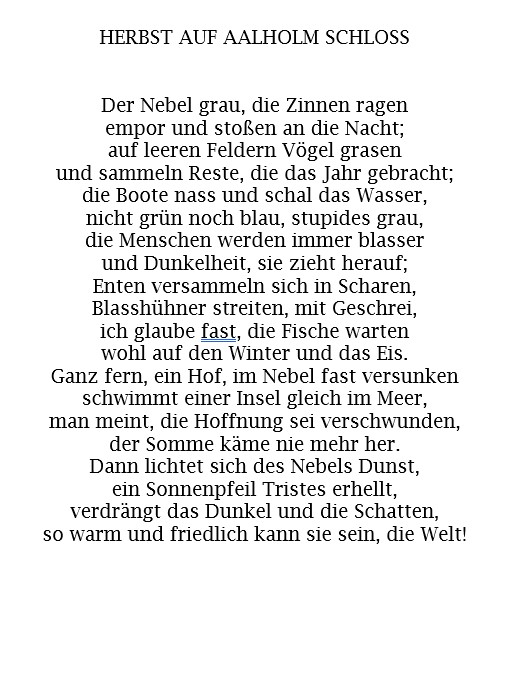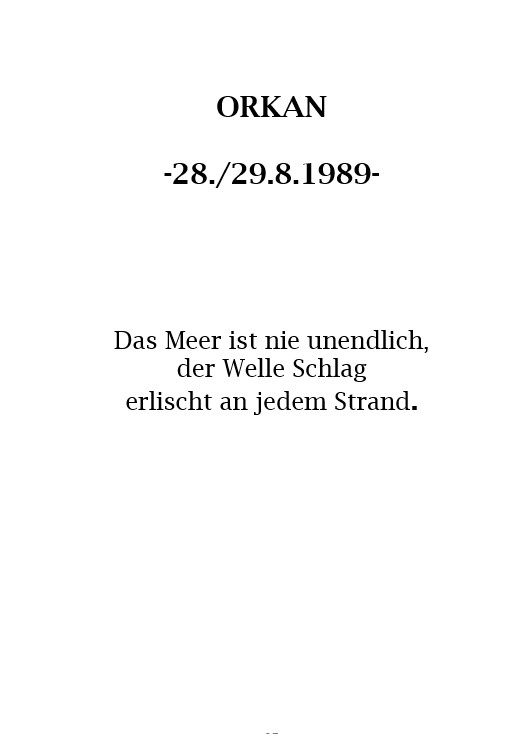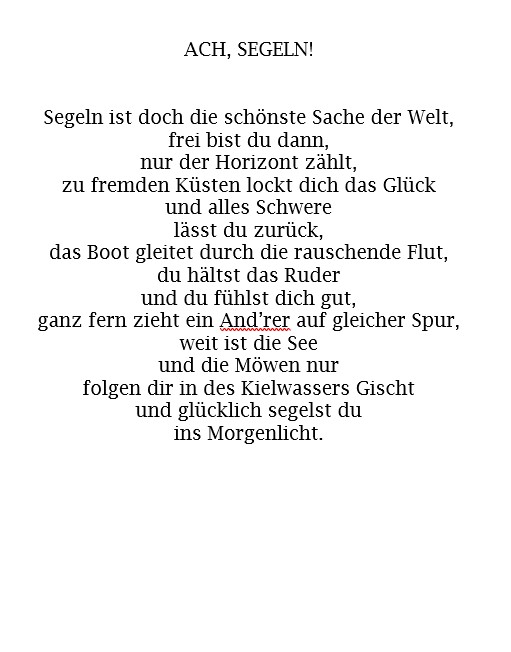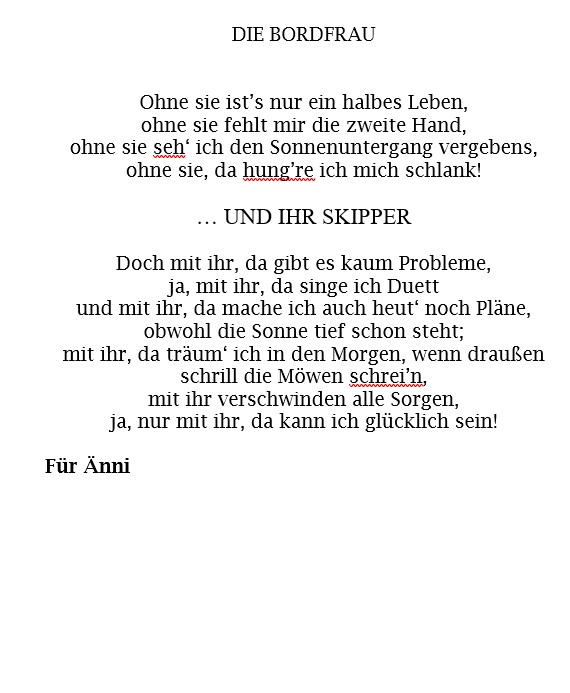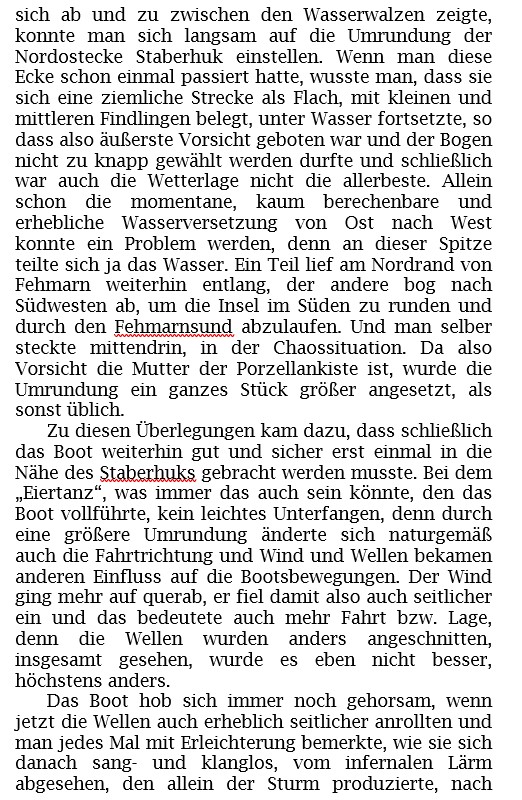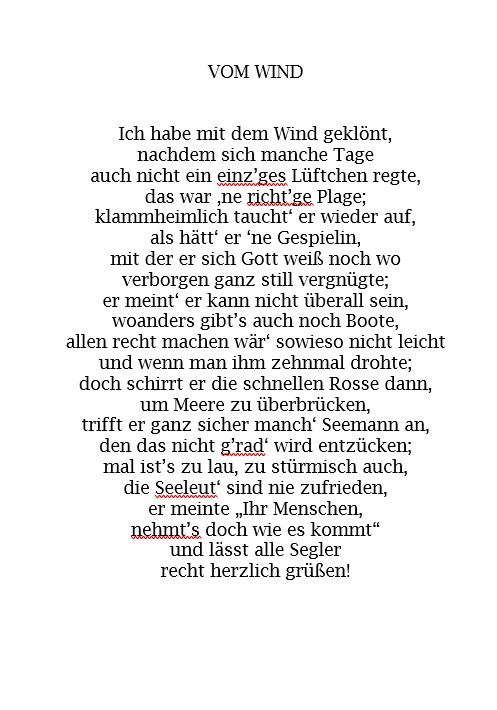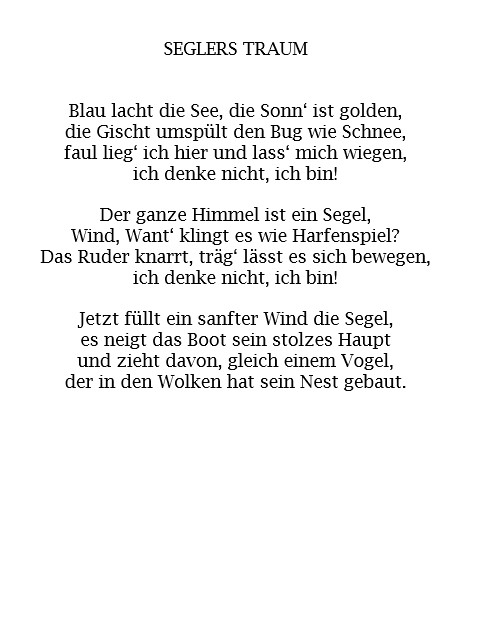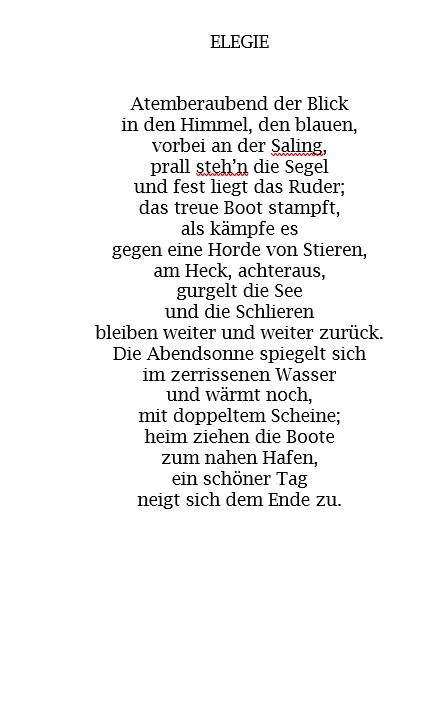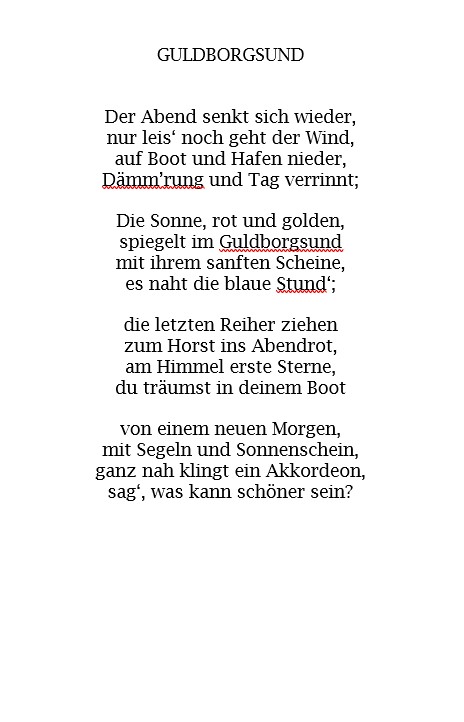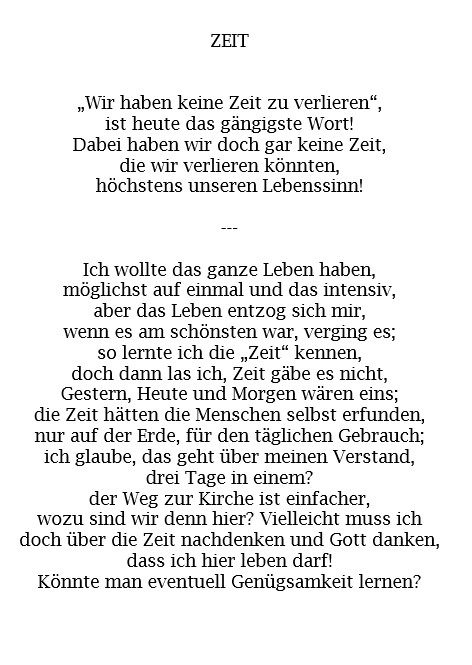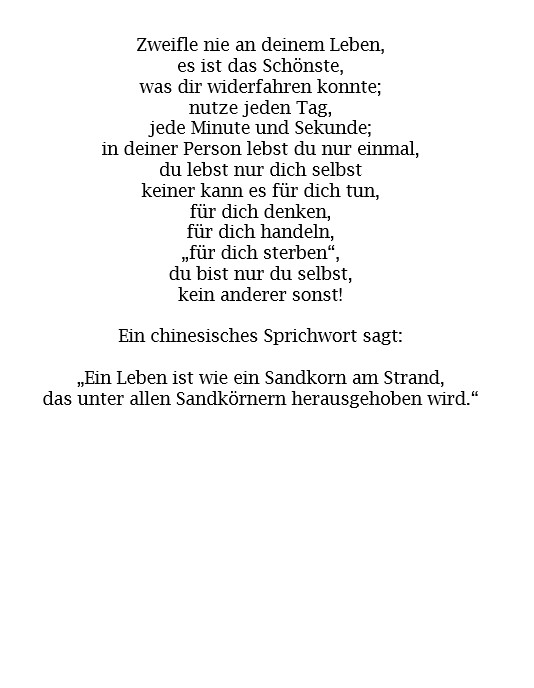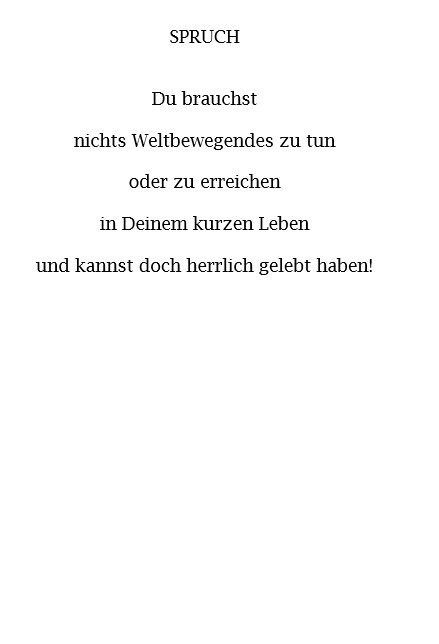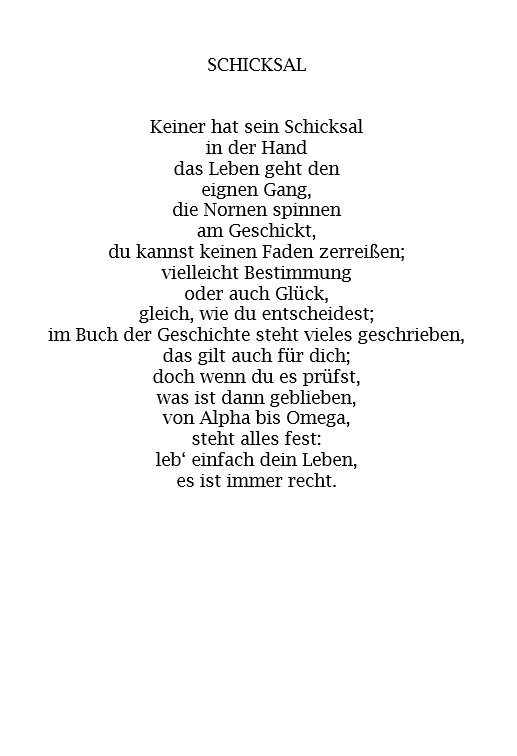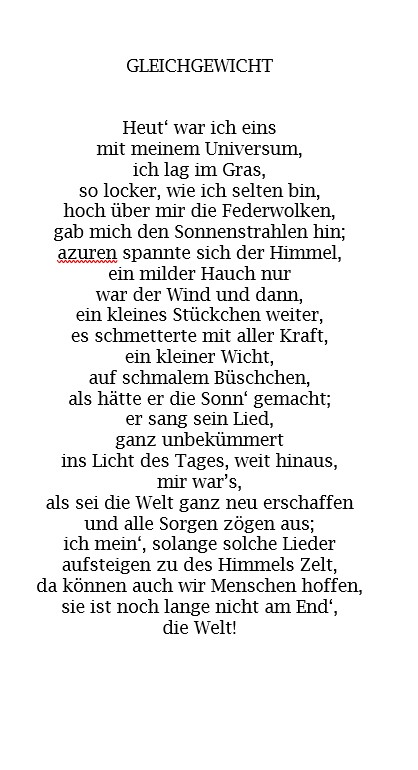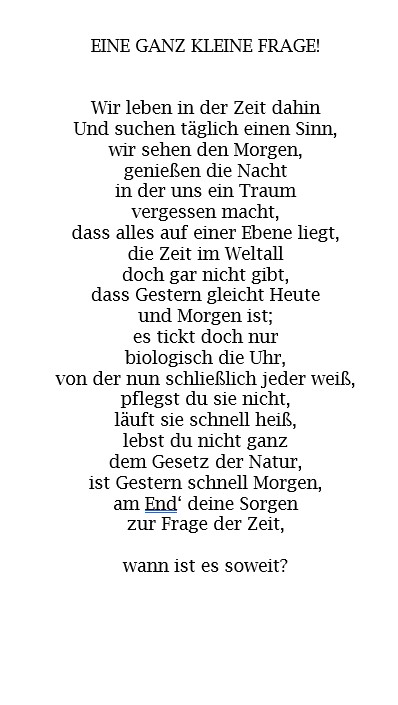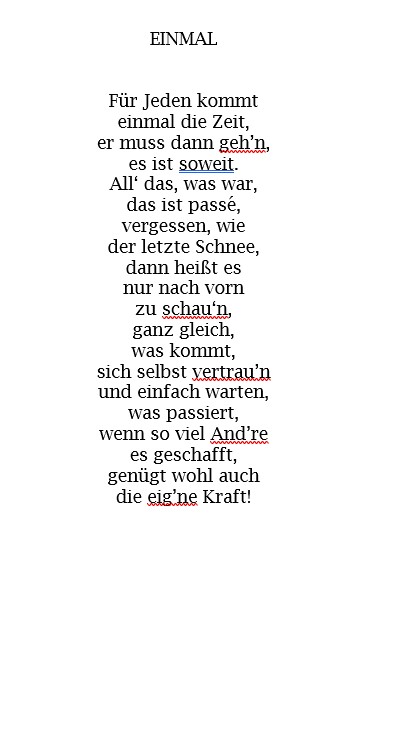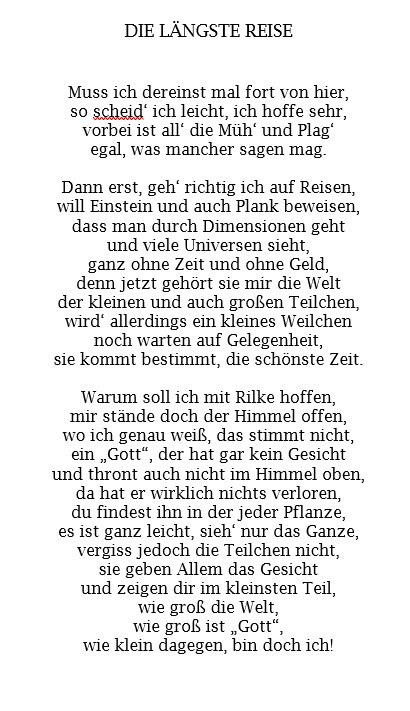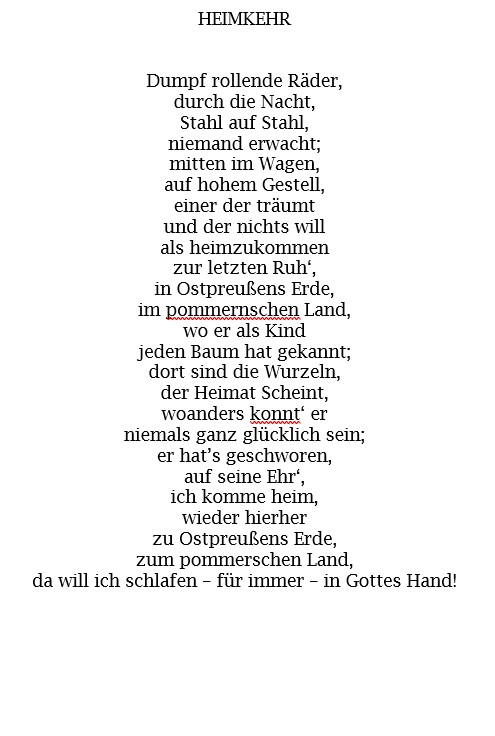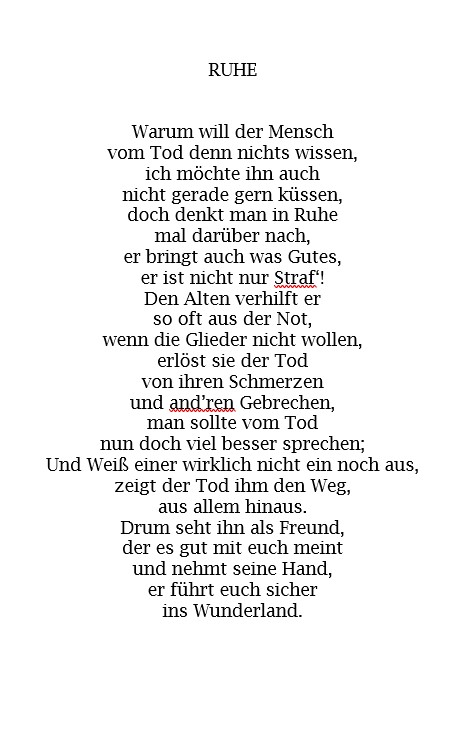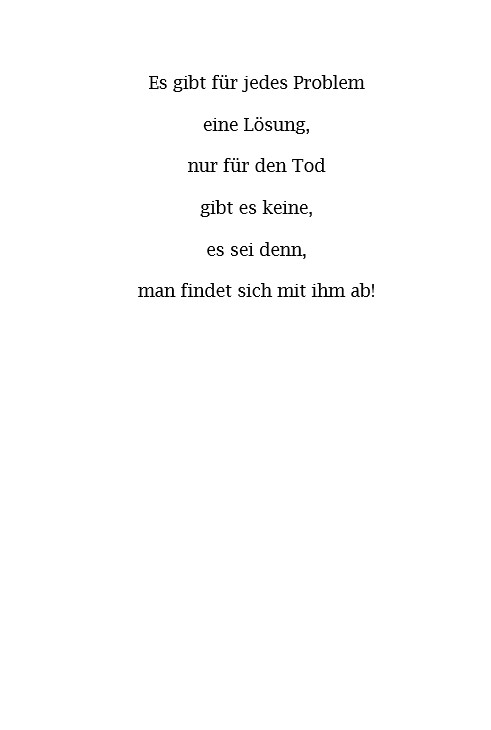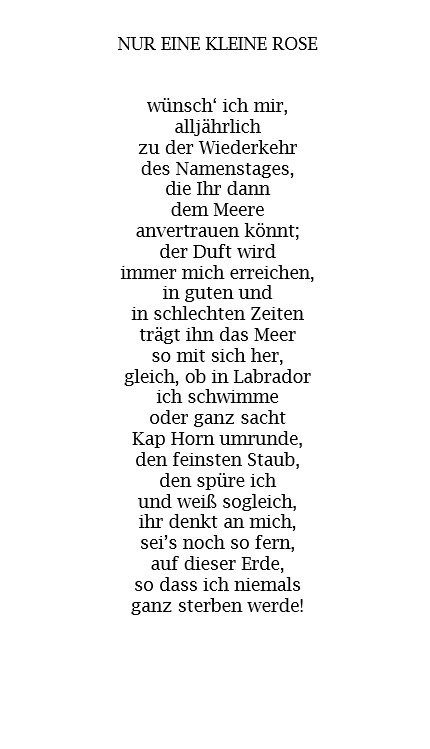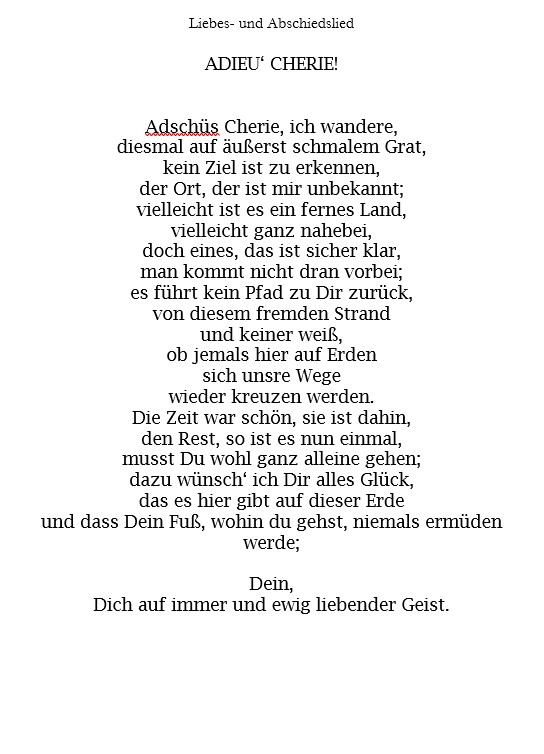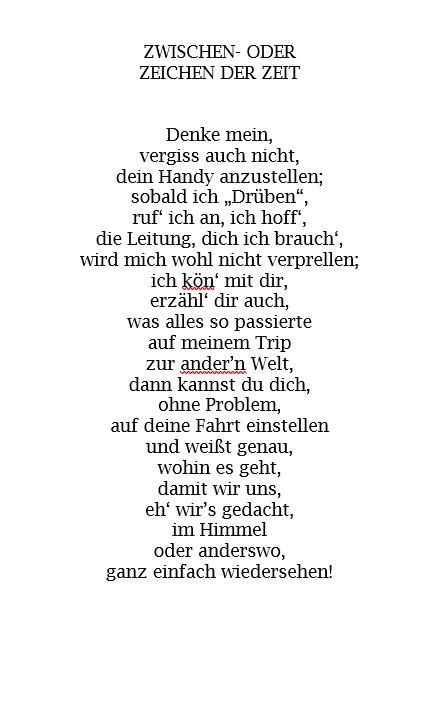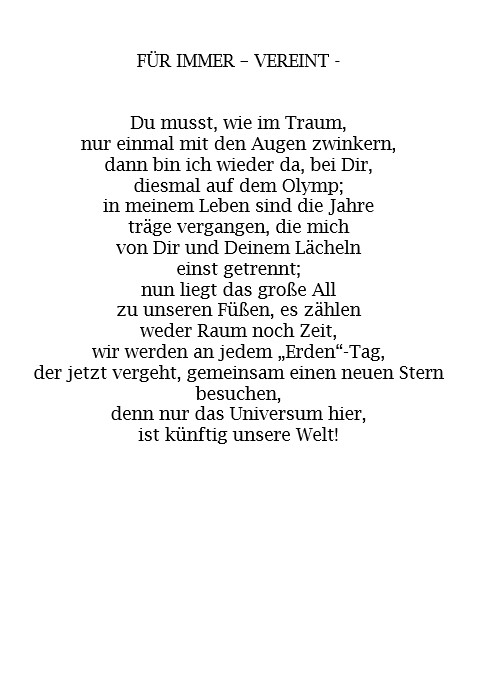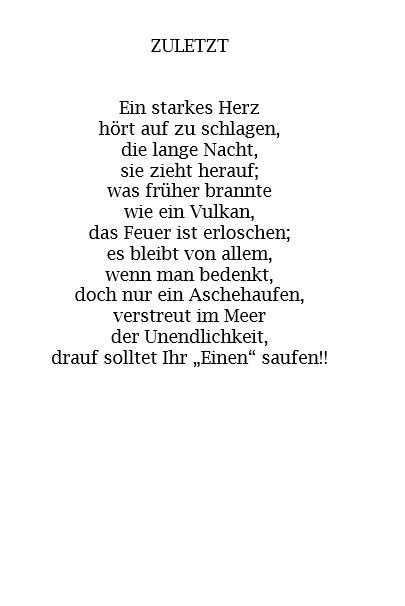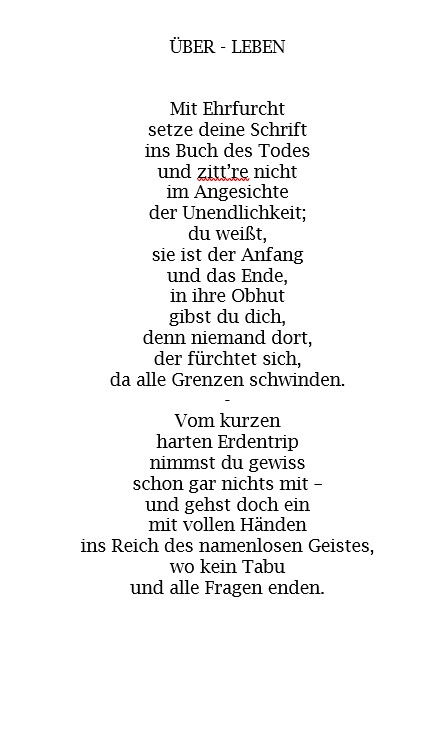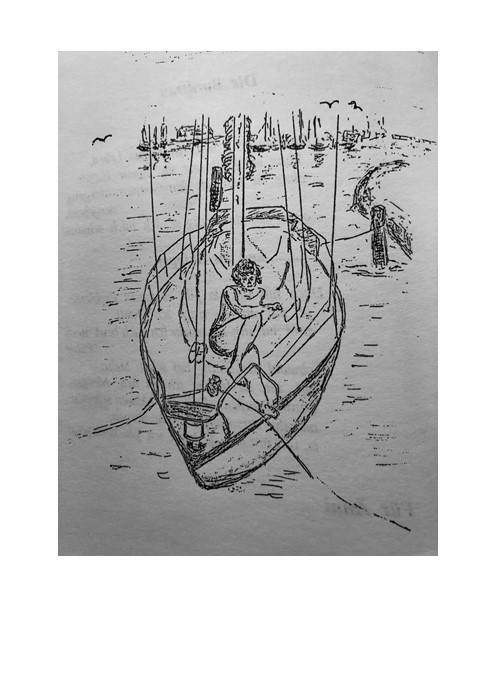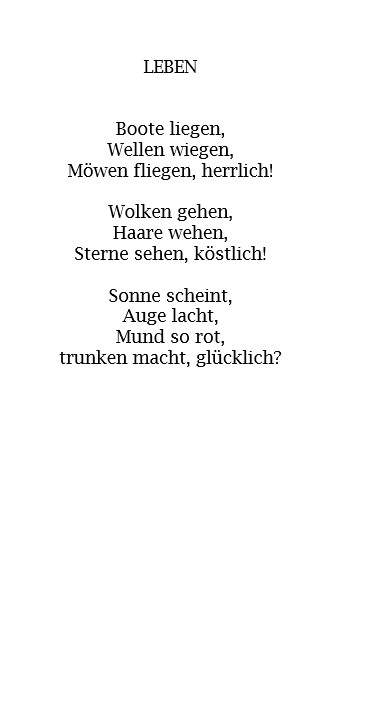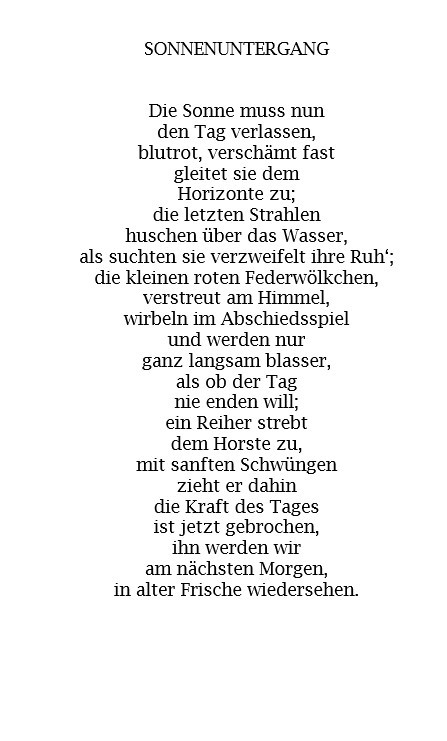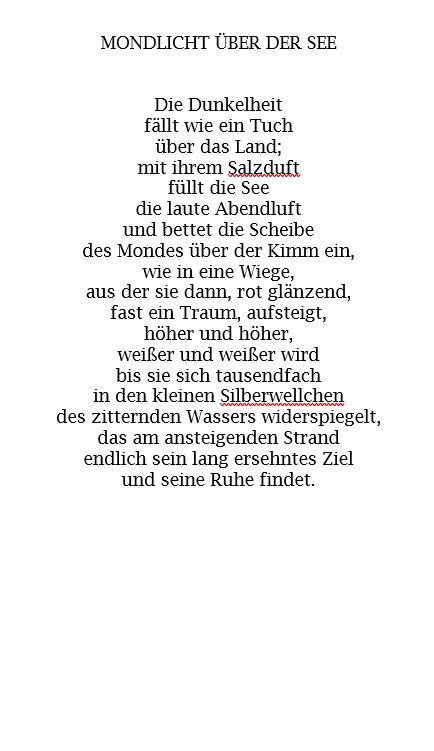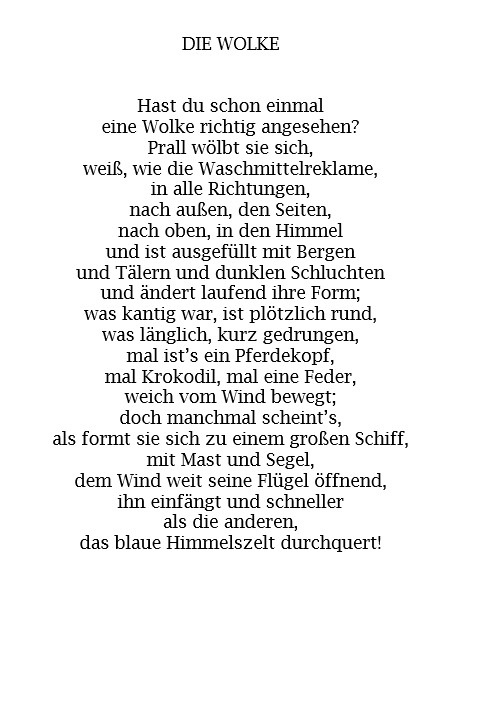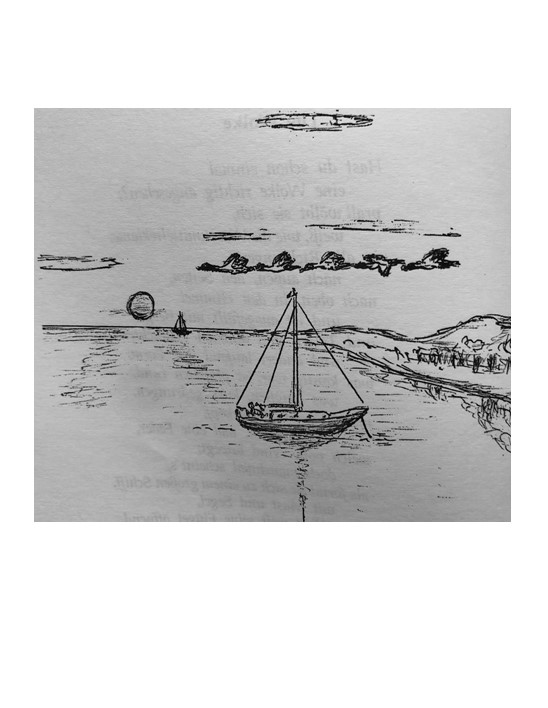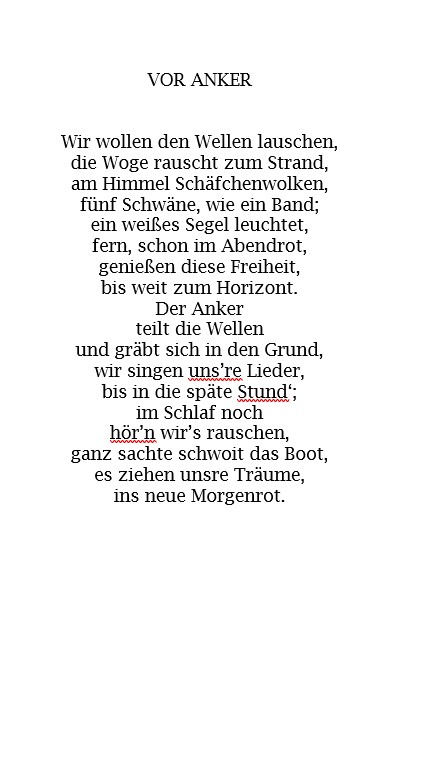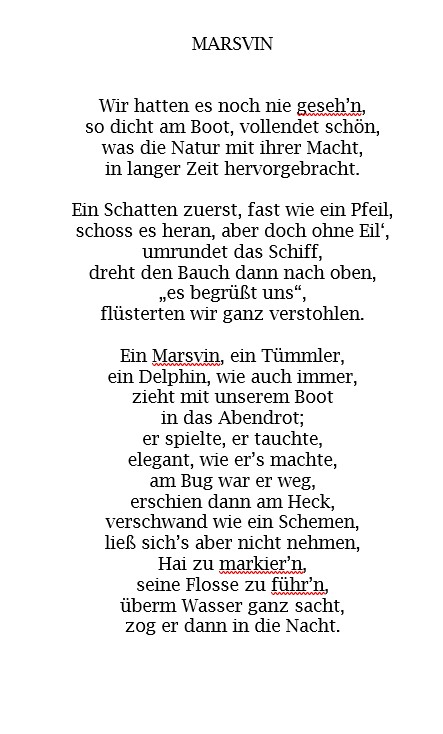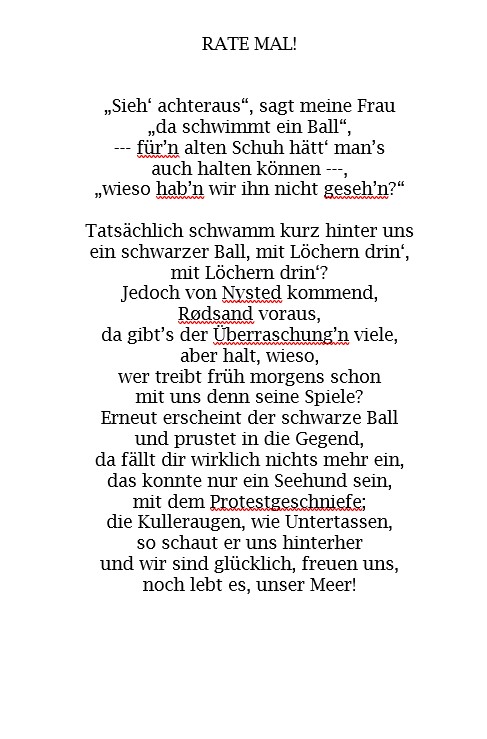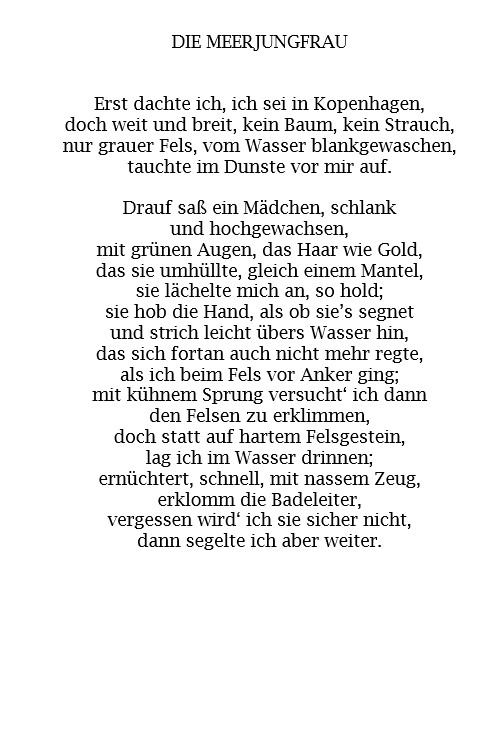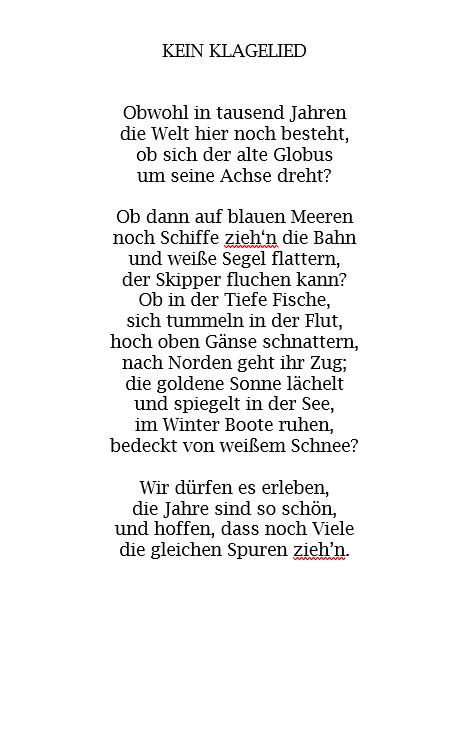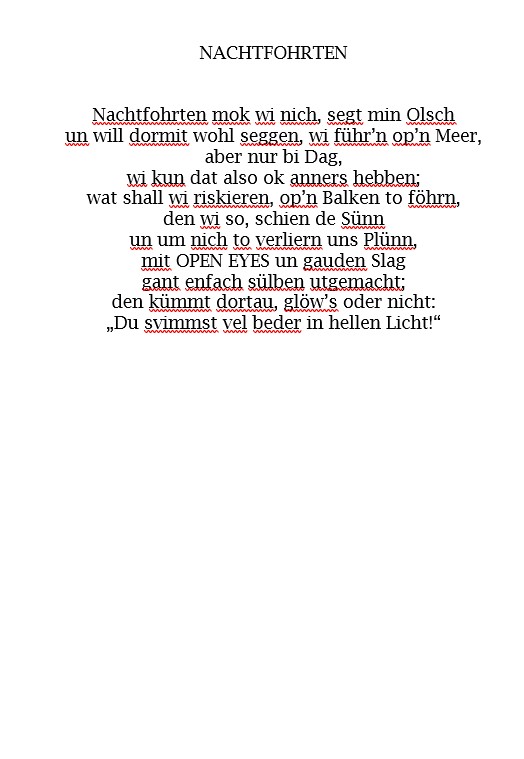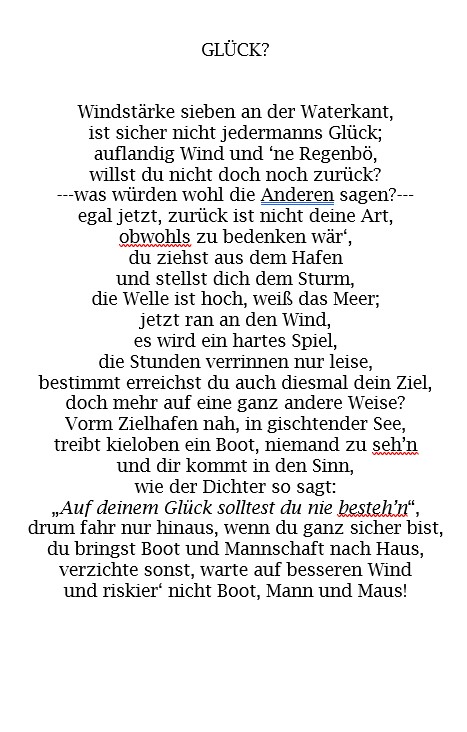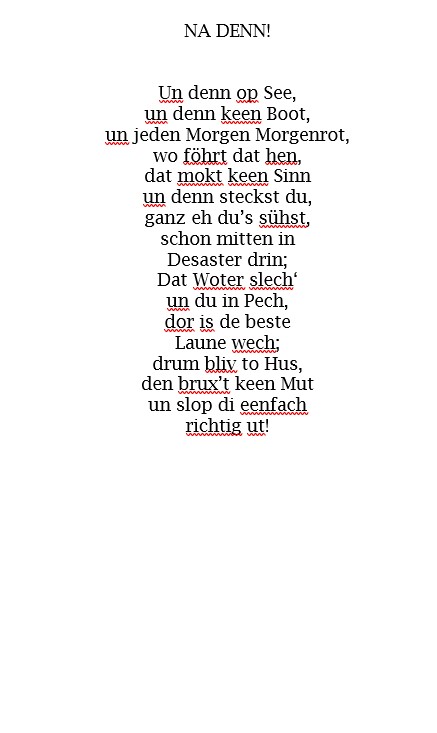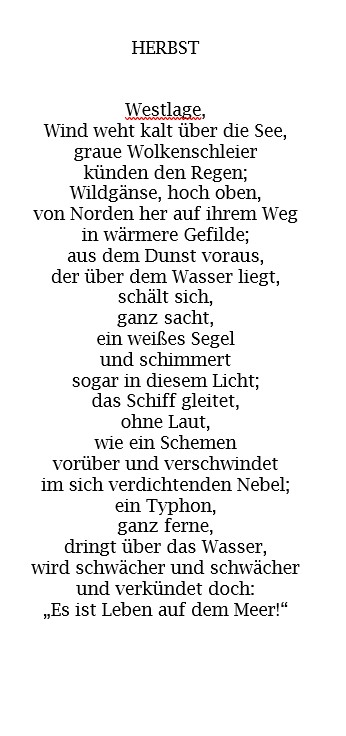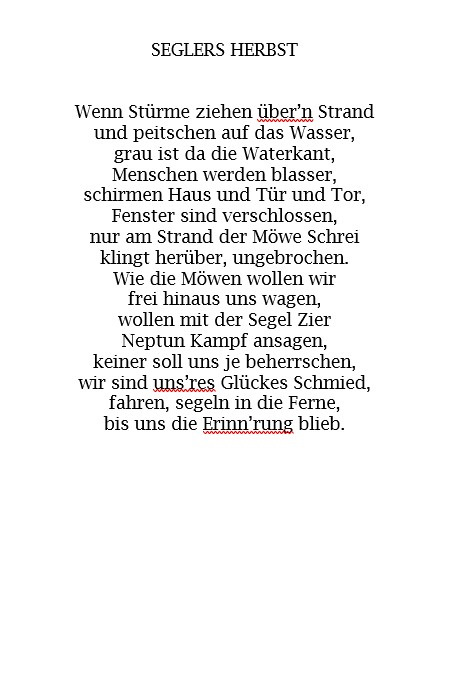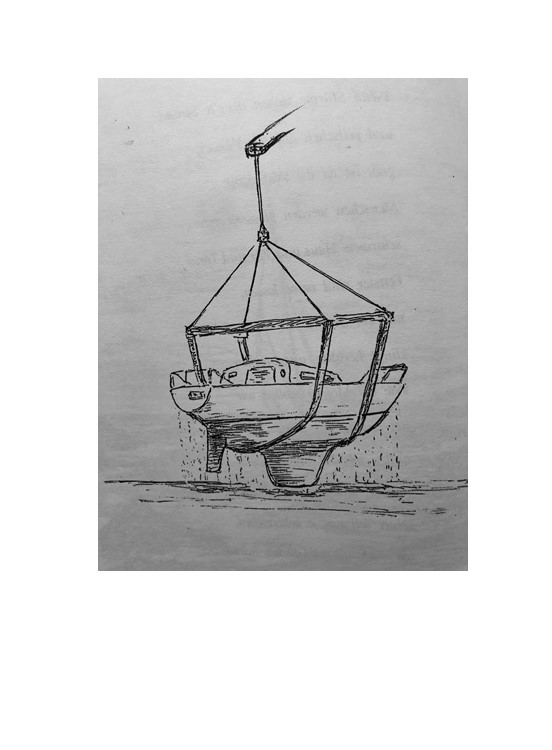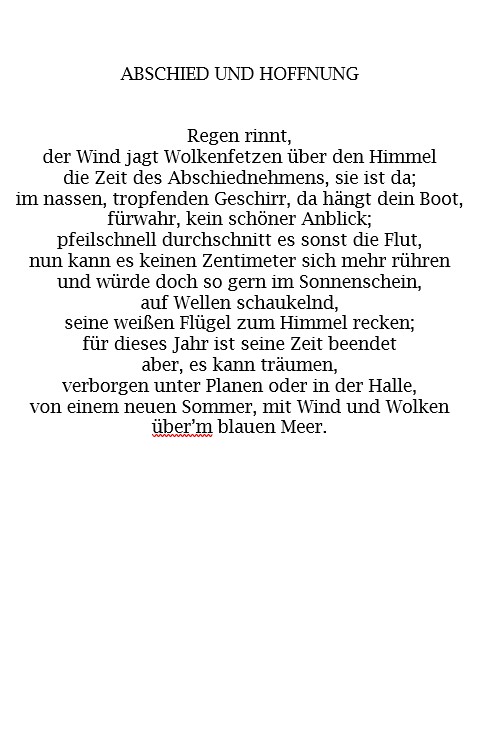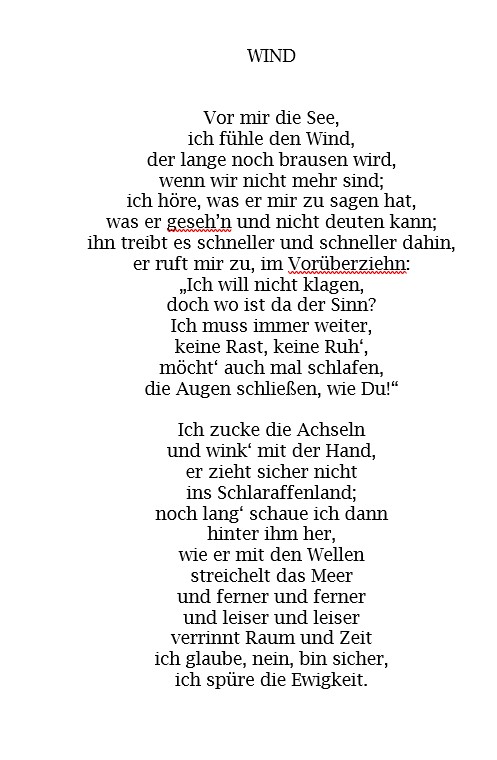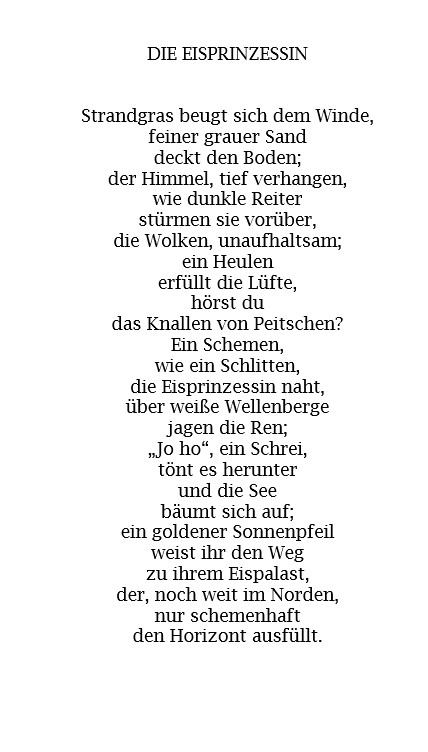Horst Schulz
Liebe und Hafen
Gedichte & Geschichten über die Liebe, die See und andere Kuriositäten.

ÜBER DEN AUTOR
Segler aus Leidenschaft.
Dichter aus Spaß an der Freude.
Ehemann, Vater, Großvater & Urgroßvater.
Ewig jung geblieben.
Liebe
Hafen
Orkan
Dies ist eine wahre Geschichte, man schrieb den 28./29. August 1989, ein Wochenende; allein das Zahlenspiel hätte einem zu denken geben können. Vorausgegangen war ein schöner Segelurlaub in den dänischen Inseln, der sich allmählich dem Ende zu neigte nach dem Motto, für die Hinfahrt zum Ziel ein Drittel, für die Rückfahrt zwei Drittel der Urlaubszeit und so wurde es immer gehalten.
Das Wetter war super und der letzte Abend im kleinen Hafenstädtchen Nysted, an der Südküste Lollands gelegen, verlief sehr angenehm mit einem herrlichen Sonnenuntergang, der das Aalholmschloss, gleich neben dem Hafen, in goldfarbenes Licht tauchte, bis sich nur noch die kleinen Türmchen gegen den sich allmählich verdunkelnden Abendhimmel abzeichneten. Lolland und Falster, Inseln, die zur „dänischen Südsee“ gerechnet werden, sind nicht nur mit dem Boote eine Reise wert. Zum Schloss gehört auch ein Automobilmuseum, dessen Inhalt sich sehen lassen kann, bis hin zum ausrangierten Jagdflugzeug „Viggen“.
Der Norden Lollands birgt eine andere Seltenheit, einen Tierpark, mit freilaufenden Tieren vom Nashorn über Giraffen, bis zum Strauß und Kamel; die Elefanten sollte man nicht so ganz vergessen. Tiger u.ä. befinden sich selbstverständlich im Gehege und das alles nicht viel mehr als 30, je nach Streckenbenutzung evtl. bis etwa 50 Autominuten von Nysted entfernt.
Aber zurück; nach Erreichen des Nystedter Hafens also hatte man sich, wie üblich, mit den ebenfalls eingelaufenen Nachbarn bekannt gemacht und war sich auf Anhieb sympathisch, man beschloss, am morgigen Sonnabend gemeinsam den Restweg nach Deutschland anzutreten, d.h. zusammen den Belt zu überqueren, etwa so:
„Zu zweit ist es etwas sicher, als allein.“ Immerhin war jederzeit mit einem Besuch der „Grauen Wölfe“ sprich DDR-Küstenwachboote, die sich immer vor der Nordküste Fehmarns, allerdings noch außerhalb der 3-Meilen-Zone aufhielten, zu rechnen, neben anderen Feinheiten.
Der Sonnabendvormittag konnte wirklich nicht besser sein, der Seewetterbericht hatte für das Wochenende nur Gutes berichtet, die Sonne knallte vom Himmel, der Wind wehte mit schwacher Damenbrise, was sollte da eigentlich noch schiefgehen? Mit einem weinenden und einem lachenden Auge wurden die Boote losgeworfen und unter Motor ging es in den Tonnenstrich, d.h. um die dänischen Gewässer verlassen zu können, musste man etwa eine knappe Stunde lang genau die Fahrrinne einhalten und das Motorengeräusch in Kauf nehmen, das Segeln würde dann draußen auf dem Belt beginnen, wobei die Überfahrtszeit für den Belt mit etwa vier Stunden anzusetzen wäre. Als das Ende der Fahrrinne, die Östermärkerdurchfahrt – eine Enge von etwa dreißig Metern zwischen zwei kilometerlangen Sandbänken – erreicht war, hatte sich der Wind auf eine mittlere Damenbrise gesteigert und so ging es nach dem Segelsetzen auf den Belt hinaus.
Über Fehmarn lag noch eine Dunstschicht und man ging davon aus, dass sie sich, wie immer, in den nächsten Stunden auflösen würde. Allerdings briste der Wind langsam aber stetig auf, so dass er etwa eine Stärke von sechs Bf erreichte, ehe man die Beltmitte querte. Damit erhöhten sich naturgemäß auch die Wellen, die zu dieser Zeit eine Höhe von etwa 1,50 Meter hatten. Die beiden Segler fuhren in einem Abstand von zwanzig Metern nebeneinander her und man unterhielt sich jetzt über Bordfunk, da die Zurufe kaum noch den Empfänger erreichten. Man war übereingekommen, in den Wind zu gehen und die Segel zu reffen, d.h. zu verkleinern, der Windstärke entsprechend. Beide Boote waren sehr gute sichere Segler – für die Eingeweihten: es handelte sich um eine Vindö 40 und eine Bandholm 24; letztere, der kleinste derzeitige Schwerwettersegler mit einem Ballastanteil von 50% des Gesamtgewichts-, solange alle Luken dicht blieben, war das Boot ein Stehaufmännchen, das sich sogar nach einem Durchkentern wieder aufrichten würde; die Vindö, ein sog. Langkieler, besaß mit die besten Fahreigenschaften damaliger Segler.
Zu den vorher angedeuteten „Feinheiten“ zählten neben den DDR-Booten übrigens auch Containerschiffe und Frachter, die nicht gerade gemütlich die Weltmeere befuhren; einige Nationen scheinen permanent unter Personalmangel zu leiden, vielleicht litten sie auch des Öfteren unter Ruderschaden, man musste in jedem Fall immer davon ausgehen, dass dort auf einen zu rauschende Schiff würde mit größter Sicherheit nicht ausweichen. Es soll Skipper auf den Sportbooten gegeben haben, die mit roter Leuchtmunition auf das auf sie direkt zulaufende Schiff geschossen haben und voll die Brücke trafen, auf der sich nach Adam Riesen eine Brückenwache hätte befinden müssen, aber es folgte keine Reaktion, tscha, sehr seltsam, vor allem waren es meistens Schiffe ohne Landesflagge mit kyrillischen Buchstaben vorn und am Heck.
Nun, solange normales Wetter blieb, war das ganze kein Problem, aber wenn; und dieses wenn zeichnete sich mehr und mehr ab. Die Sonne hatte sich hinter diffuse Wolkenschleier zurückgezogen und gab nur noch als hellerer Fleck die Ehre. Der Wind brachte schon einige Regentropfen mit sich, die sich nach und nach vermehrten und legte selbst auch klammheimlich zu, dass beide Bootsführer zum Schluss kamen: weniger ist mehr! Und das bezog sich natürlich auf die Segelfläche, die einzige Möglichkeit, das Boot im Griff zu behalten, denn auszusteigen wie beim Auto und stehen zu lassen, war jawohl kaum möglich; die Devise hieß also: Augen „fast“ zu und durch.
Das Reffen, oft erprobte Segelverkleinerung, brachte ein weitere Problem. Das Boot musste mit dem Bug, der Bootsspitze, in den Wind also genau gegen an gebracht werden, damit die Segel flattern und heruntergenommen werden konnten. Bei der zu dieser Zeit bereits herrschenden Windstärke mit dem entsprechenden Seegang schon gar keine Kleinigkeit mehr, da der Bug Fahrstuhleigenschaften entwickelte und ein Arbeiten ohne Rettungsleine nicht mehr möglich war; das Schiff verschwand urplötzlich unter den Füßen des Skippers und er musste sich voll darauf konzentrieren, wieder Bootsberührung zu bekommen.
Ohne Absprache veranlasste das beide Bootsführer zu diesem Zeitpunkt schon das kleinste Vorsegel, die Sturmfock – nicht viel größer als ein Taschentuch – zu setzen, um sich weitere Arbeiten vorn zu ersparen. Dementsprechend fiel auch das Reffen des Großsegels aus. Es mutete schon wie ein Wunder an, dass die Boote überhaupt noch liefen und wie sie liefen; das Sumlog der Bandholm – beim Auto der Tacho -, zeigte bei Talfahrt zu diesem Zeitpunkt schon 12 Knoten, also etwa 22 km/h an und ging später sogar bis auf 17 kn, also ca. 31 km/h hoch, obwohl es nach Angaben des Herstellers über eine Rumpfgeschwindigkeit von 6,5 kn, also 12 km/h, gar nicht hinauskommen kann – was es nicht so alles gibt.
Da beide Boote entsprechend ihrer Größe gerefft hatten, behielten sie auch in etwa die gleiche Geschwindigkeit, der Wind war etwas achterlicher als querab, so dass bis auf die seitliche Wellenbewegung und deren Höhe das Segeln so einigermaßen erträglich blieb. Das Unangenehmste wurde allerdings das fliegende Wasser, das sich durch den immer stärker aufbrisenden Wind, er dürfte etwa eine Stärke um die 9 Bf zu dieser Zeit gehabt haben, wie eine zweite Wasserfront auswirkte. Zum Glück kam sie seitlich von hinten und so hatte man das Gesicht frei.
Als die Kapitänöse einmal ausrief: „Sieh dir bloß die Wellenhöhe achteraus an“, meinte der Skipper: „Schau nach vorn Mädchen, da spielt die Musik, das andere liegt hinter uns“, was zwar indirekt stimmte, aber er wusste auch genau, dass man alles, was von achtern kam doch nicht aus den Augen lassen durfte, schließlich schätze er die augenblickliche Höhe der Wellen selbst auf etwa vier Meter und das war beileibe kein Pappanstiel mehr; das Schiff brauchte sich nur einmal auf einem Wellenkamm zu drehen, dann Prost Mahlzeit! Solche Situationen ließen sich nur mit dem Ruder ausbalancieren und dafür musste jegliche Wellenbewegung in der nächsten Umgebung permanent beobachtet werden.
Aber noch lief alles ganz gut ab, den Nachbarn hatte man wohl im Visier, zwar mehr unterhalb der sich hoch aufbäumenden Wellenkämme, aber solange noch das obere Drittel des Mastes sichtbar war, musste sich das restliche Schiff darunter befinden. Seltsamerweise schien niemand Angst zu empfinden, im Gegenteil, man beobachtete vielmehr interessiert die Situation in den vielen Einzelheiten, denn wann befindet man sich schon einmal in einem solchen Sturm, der praktisch aus dem Nichts auftauchte.
Jeder wusste ja, was zu tun ist, wenige Worte, manchmal nur einfache Handbewegungen reichten aus, um eine Maßnahme, die erforderlich wurde, einzuleiten. Denn wie bereits ausführlich erläutert, rechts ranfahren und aussteigen war nicht und wurde eben auch nicht diskutiert, schließlich war man schon einige Jahre auf dem Wasser zugange und kannte die Materie in „fast“ allen Situationen.
Hin und wieder wurde das andere Boot angefunkt, ob noch alles o.k. sei. So verging eine Viertelstunde nach der anderen und, nachdem nun auch Fehmarn sich ab und zu zwischen den Wasserwalzen zeigte, konnte man sich langsam auf die Umrundung der Nordostecke Staberhuk einstellen. Wenn man diese Ecke schon einmal passiert hatte, wusste man, dass sie sich eine ziemliche Strecke als Flach, mit kleinen und mittleren Findlingen belegt, unter Wasser fortsetzte, so dass also äußerste Vorsicht geboten war und der Bogen nicht zu knapp gewählt werden durfte und schließlich war auch die Wetterlage nicht die allerbeste. Allein schon die momentane, kaum berechenbare und erhebliche Wasserversetzung von Ost nach West konnte ein Problem werden, denn an dieser Spitze teilte sich ja das Wasser. Ein Teil lief am Nordrand von Fehmarn weiterhin entlang, der andere bog nach Südwesten ab, um die Insel im Süden zu runden und durch den Fehmarnsund abzulaufen. Und man selber steckte mittendrin, in der Chaossituation. Da also Vorsicht die Mutter der Porzellankiste ist, wurde die Umrundung ein ganzes Stück größer angesetzt, als sonst üblich.
Zu diesen Überlegungen kam dazu, dass schließlich das Boot weiterhin gut und sicher erst einmal in die Nähe des Staberhuks gebracht werden musste. Bei dem „Eiertanz“, was immer das auch sein könnte, den das Boot vollführte, kein leichtes Unterfangen, denn durch eine größere Umrundung änderte sich naturgemäß auch die Fahrtrichtung und Wind und Wellen bekamen anderen Einfluss auf die Bootsbewegungen. Der Wind ging mehr auf querab, er fiel damit also auch seitlicher ein und das bedeutete auch mehr Fahrt bzw. Lage, denn die Wellen wurden anders angeschnitten, insgesamt gesehen, wurde es eben nicht besser, höchstens anders.
Das Boot hob sich immer noch gehorsam, wenn jetzt die Wellen auch erheblich seitlicher anrollten und man jedes Mal mit Erleichterung bemerkte, wie sie sich danach sang- und klanglos, vom infernalen Lärm abgesehen, den allein der Sturm produzierte, nach Westen von dannen machten.
Allerdings kam nun auch das eine oder andere Mal ein ordentlicher Schwapper über die Kante und sagte deutlich und bestimmt „Guten Tag“, obwohl der wirklich nicht mehr so gut wie am Anfang war. Aber solange das Wasser nur in den Stiefeln stand, konnte man noch drüber lächeln, zwar etwas verzerrt, aber was hilft’s Rittersmann – oder so ähnlich – denn letzten Endes ging es ja hjemme, wie der Däne so zu sagen pflegt, nämlich nah Haus.
Als die „Ecke“ endlich geschafft war und Sturm und Wellen nicht mehr mit voller Wucht heranbrausten, jetzt auch mehr von achtern einfielen, hatte man nicht nur Land, sondern auch den baldigen Schluss der Höllenfahrt vor Augen; die Vindö wollten weiter nach Heiligenhafen und hatte noch etwas längere Restfahrt vor sich, die Bandholm musste nach Burgtiefe und konnte etwas früher mit dem sicheren Hafen rechnen.
Irgendwelcher Verkehr war zumindest bis zur Hafeneinfahrt nicht zu befürchten, frei war die See, soweit man überhaupt sehen konnte. In der Zufahrt Burgtiefe-Burgstaaken wurde die Maschine angeworfen und sobald die rechtwinklige Abzweigung zum Hafen Burgtiefe erreicht war und Kurst Ost anlag, konnten auch ohne größere Probleme die Segel eingeholt werden.
Der Motor hatte noch etwas zu arbeiten, um gegen den Sturm und den ca. einen Meter hohen Hafenseegang anzukommen, aber auch das war dann geschafft und, Glück im Unglück, gleich am ersten langen Steg voraus war noch ein Liegeplatz frei, an diesem Steg der einzige, aber das reichte ja. Je näher man den Stegen kam, umso mehr nahmen die Geräusche zu, soweit das überhaupt im Orgeln des Windes und dem Wellenschlag möglich war. Bei den hunderten von Segelbooten, die dort lagen, klapperten und schlugen die Wanten, knatterten irgendwelche Flaggen, kurz jaulte der Sturm in allen nur möglichen Tonarten, es war eine wahre Pracht. Da man ja direkt gegen den Wind anlegte, gab es eigentlich nur für den Skipper das Problem gut auf den Steg zu kommen, er musste ja, als die Maschine kurz ausgekuppelt wurde, um die Fahrt aus dem Schiff zu bekommen, das durch den Winddruck sofort zurücklaufende Boot schnellsten am Steg festlegen und hatte dazu sozusagen „nicht alle Zeit der Welt“, das ging nur mit artistischer Behändigkeit und bei dem hohen Wasserstand war es wahrlich nicht einfach, aber irgendwie kam man halt doch zurecht. Mit einem befreiten Aufatmen folgte der übliche Rundblick und dann gefror dem Skipper das Blut in den Adern.
In Fahrtrichtung steuerbord, also rechterhand, lag ein etwa zwölf bis vierzehn Meter langer Stahlsegler, auf der anderen Seite, eben backbord, ein ca. zwölf Meter langes Kunststoffsegelboot, man selbst hatte schlappe 7,50 m vorzuweisen, also war diese Box etwas zu groß. Dem Skipper schwante so einiges und er meinte vorsichtig: „Vielleicht sollte ich doch noch einmal weiter hinten nachsehen, ob noch Plätze frei sind.“ Nun, er kannte seine „Olsch“ und war überhaupt nicht erstaunt, als sie eine eventuell ins Auge gefasste Umlegung kategorisch ablehnte mit dem Hinweis, sie möchte was zu futtern und dann sofort in die Koje, sie sei am Ende ihres Lateins, punktum. Nach dem letzten Ausruf wusste er spätestens, was die Glocke geschlagen hatte und er beschloss erst einmal das Hafenmeisterbüro zu erkunden und sein Schiff anzumelden.
Er hatte noch nicht einmal die Klinke in der Hand, da traf ihn das Geschrei drinnen an seinem zur Zeit wundesten Punkt: „Bist du des Teufels, mit deinem kleinen P.-Boot in die einzige große Box zu gehen, die noch frei ist? Die brauche ich für eventuell noch einlaufende Boote!“ Auf die Erwiderung, es würden wohl kaum noch Schiffe einlaufen, meinte der Hafenmeister: „Woher willst du das wissen?“ Darauf die trockene Antwort: „Wir kommen gerade aus Dänemark und soweit wir sehen konnten, war die See frei.“ Eine kleine Pause, die der Skipper unterbracht mit der Frage: „Was zeigt denn deine Windmaschine eigentlich an?“ Ein kurzer Blick und die Antwort: „Zehn ½, in Böen Elf.“ Danach kam nichts mehr als: „Aber Morgen früh als erstes legst du um, o.k.?“ Das Antwort-o.k. kam ziemlich erleichtert und so trat er den Rückweg zum Schiff an, nachdem er noch erfahren hatte, das alle Mann aus dem Hafenbereich im Einsatz waren und es von Notmeldungen nur so hagelte; es wusste immer noch niemand, dass man es mit einem ausgewachsenen Orkan zu tun hatte, der auf keinen Fall am nächsten Morgen abgezogen sein würde. Als er mit einiger Mühe wieder sein Schiff erklommen hatte, das Wasser stand auf einem etwas höheren Stand als vorher, mussten erst einmal die Leinen verlängert werden, ehe er in die Kajüte hinunterstieg.
Das Abendessen brutzelte schon in der Pfanne und abgesehen von dem draußen herrschenden Krach und Gejaule konnte man nun nach Stunden der Anspannung endlich doch ein wenig abschalten. Die Kapitänöse sah ihn nur einmal kurz prüfend an und als er nickte und ein: „Alles o.k.“ hinzufügte, lächelte sie zum ersten Male seit Stunden und drehte sich herum, um ihren Kocher weiter zu bedienen.
Nach dem Essen wurde die augenblickliche Lage beleuchtet und die Vorbereitungen für eine voraussichtlich nicht so angenehme Nacht besprochen. Da der Wind ganz langsam nach Nord drehte, legten sich auch die ganzen Boote folgsam sachte auf die Steuerbordseite und für die Bordfrau war daher diese Kojenseite doch die angenehmste, sie konnte auf keinen Fall herausfallen und die Koje ließ sich recht gemütlich einrichten, mit viel Decken und Kissen.
Der Skipper hatte mit der Backbordkoje vorlieb zu nehmen, zumal ihm ja die Aufgabe der Bootsüberwachung zufiel. D.h. er musste und wollte natürlich so alle 30 Minuten einmal draußen überprüfen, ob alles noch im Lot war, denn wenn sich eines der Nachbarboote irgendwie in Bewegung setzen sollte, also vielleicht eine Festmacherleine riss oder sich von den Stegpfählen lösen würde, könnte es für die Nebenlieger leicht unangenehm und unruhig werden.
Allein schon die Bootsbefestigungen am Steg waren dem Skipper seit jeher unheimlich, er lag ja nicht das erste Jahr in Burgtiefe, nur bisher nie bei einer solchen Wetterlage. Für jedes Boot waren zwei Pfahlenden von etwa zehn Zentimeter Höhe als Festmacher vorgesehen, die über den Steg ragten. Sie trugen beide einen ziemlich spitz zulaufenden Metallhut, der wohl in heißem Zustand auf den jeweiligen Pfahl aufgesetzt wurde und sich dann nach Erkalten fest über dem Pfahl zusammenzog; er hatte eine Stärke von vielleicht 10 mm. Grundsätzlich war er stabil genug nur, wenn über dem Hut ein 13 Meter langes Stahlschiff steil emporragte, dessen Leinen dazu straff gespannt waren und das sicherlich auch einige über zehn Tonnen Gesicht auf die Waage brachte, konnte man schon ein wenig ins Grübeln kommen, vor allem, wenn man direkt daneben mit seinem Boot lag und das bei Windstärke zwölf. Vergessen durfte man wohl auch nicht, dass das Wasser unaufhaltsam stieg und nirgendwo fand sich ein armer Mensch, der die Festmacher ein wenig verlängern würde, denn außer auf der Bandholm war auf dem ganzen Steg mit seinen etwa 20 Schiffen kein einziges besetzt. Die Eigner hatten wohl alle den 7. Sinn gehabt und befanden sich woanders; bestimmt waren sie auch gut versichert.
Um noch einmal auf die Bugbefestigung zurückzukommen, die jetzt bereits straffen Leinen rutschten also mit dem steigenden Wasserstand an den Pfahlköpfen hoch und beendeten ihre Aufwärtsfahrt endgültig unter besagtem Eisenhut von etwa 10 mm Stärke, wobei offenblieb, ob der Hut seinen Platz behielt oder sich vielleicht sogar katapultmäßig vom angestammten Pfahl verabschiedete. Das betreffende Boot wäre erst einmal frei und könnte versuchen auf Wanderschaft zu gehen.
Das waren also in etwa die Gedanken des Skippers und er stellt daraufhin Überlegungen an, was ist zu tun, wenn. Schlimmstenfalls würde er das Boot loswerfen und die Box so fix wie möglich verlassen. Besser am Ufer zu stranden, als sich zwischen Riesen zermahlen zu lassen.
Bei seinem letzten Rundgang, die Windwalzen hatten zwei- bis dreimal versucht, ihn vom Steg zu befördern, stand das Wasser an die zwanzig Zentimeter über dem Steg und er beschloss, weitere Überprüfungen nur noch von Bord aus vorzunehmen, um das Risiko möglichst gering zu halten. Immerhin konnte er an den gestrafften Leinen, die jetzt ja schon im Wasser verschwanden, erkennen, dass die Schiffe mit den Vorleinen noch fest waren.
Etwa so gegen Mitternacht, die Stegbeleuchtung zeigte bisher keinen Ausfall, hatte er dann ein Erlebnis der besonderen Art. Am gegenüberliegenden Rundsteg versuchte sich ein stabiles Beiboot mit sicherlich einigen Kilo Eigengewicht im Höhenflug. Es war wieder eine der unzähligen Windwalzen, in der es begann, sich plötzlich zu erheben; es schwebte ca. ein bis eineinhalb Meter und das wohl mindestens eine halbe Minute lang über dem Wasser. Der Skipper folgte gebannt dem ungewohnten Anblick solange, bis es sich wieder folgsam auf dem Wasser niederließ, schließlich sieht man so etwas nicht alle Tage oder besser gesagt alle Nächte.
Nach Rückkehr in die Kajüte war seine bessere Hälfte so etwa halbwach und beklagte sich murmelnder Weise, dass das wohl die verrückteste Nacht ihres Lebens sei und ob er das nicht etwas abstellen könnte und dabei wurde von ihr ein einprägsamer Ausspruch getan, es wäre wohl „die Nacht der hunderttausend Teufel“, womit sie bestimmt nicht so ganz daneben lag, bei diesem infernalischen Lärm konnte man wirklich sein Gehör verlieren.
Als er etwas später seinen nächsten „Rundblick“ durchführen wollte, war es stockdunkel, d.h. die gesamte Beleuchtung war ausgefallen oder aus Sicherheitsgründen abgeschaltet worden. Nun konnte er wirklich nur noch seine allernächste Umgebung kontrollieren und eben hoffen, dass nichts Außergewöhnliches passierte, ehe der Morgen anbrach. Und der kam Ende August natürlich nicht mehr so früh, wie im Juni und bei diesem herrlichen Wetter logischerweise zäh wie ein Kaugummi. Das Alles trug auch nicht gerade dazu bei, fröhlichere Gefühle zu erwecken und dann verschlug es ihm tatsächlich doch die Sprache, als er sich wieder einmal nach vorn gearbeitet hatte und mit der Handlampe den großen Rundblick machen wollte. Abgesehen davon, dass der Steg jetzt etwa oder besser gut einen halben Meter unter Wasser lag, tauchte plötzlich im Lampenlicht ganz kurz vor ihm und auch in seiner Höhe, ein riesiges Bugspriet auf – eine Schiffsverlängerung, die es ermöglicht, zusätzliche Vorsegel setzen zu können, bei wenig Wind. Dadurch, dass die Vorleinen der Boote nicht verlängert wurden, beziehungswiese nicht werden konnte, standen die Schiffe fast senkrecht über dem Steg und hatten im Falle des Bugspriets fast schon Kontakt mit dem gegenüberliegenden Boot und das war zu seinem Pech sein eigenes. Nur konnte er hier aber auch überhaupt nichts daran ändern und nur hoffen, dass besonders dieses Schiff sehr gut vertäut war und sie nicht im Laufe der restlichen Nacht besuchen würde. Na ja, diese Nacht unterschied sich sowieso etwas von allen bisherigen, das ließ sich nicht leugnen.
Ganz träge begann sich der Nachthimmel zu verändern und bekam so ein verwachsenes Dunkelgrau, das nur ganz zögerlich einige hellere Töne annahm. „Wenn man sehnsüchtig auf etwas wartet, lässt es sich erst recht Zeit“, dachte der Skipper in seiner Koje und beobachtete dabei die grauen Wolkenfetzen durch sein Kojenfenster, die vom Sturm gejagt über das Schiff rasten.
Aber irgendwann ist auch die längste Nacht vorbei; als er nun doch ein wenig einduselte und dann plötzlich aufschreckte, war es auf seiner Armbanduhr tatsächlich schon fast sechs Uhr und draußen alles hell, soweit es bei diesem Wetter möglich sein konnte. Raus aus der Koje, das Ölzeug über und schon stolperte er wieder, noch halb schlaftrunken, den Niedergang hoch. Das Prasseln des Regens hatte aufgehört und der erste Rundblick ergab keine auffallenden Veränderungen in seiner näheren Umgebung; das beruhige schon, für den Anfang. Der Wind hatte weiter über Nord gedreht, alle Schiffe lagen in Schräglage, aber fest. Das Wasser stand immer noch hoch, vielleicht auch einige Zentimeter höher als nachts und als er seine Inspektion vorn beendet hatte und am Kajüteneingang auftauchte, blinzelte ihn sogar die Bordfrau an und meinte trocken: „Jetzt nichts wie hier raus und an Land, fürs Erste reicht’s mir. Die Bäckerei an den Hochhäusern macht mindestens um Sieben auf, mit frischen Brötchen soll man nicht knausern, wenn wir sie dort nicht essen können, gehen wir in die Kurverwaltung, die ist sicher schon geöffnet.“ Der Skipper sah sie etwas zweifelnd an und meinte, sie sollte sich vielleicht erst einmal was überziehen und dann könnten sie das Weitere mal vorn am Bug besprechen. Als sie halb kriechenderweise dort angekommen waren, blickte sie über den Steg, der nicht da war, schaut ihn an und die Frage kam: „Was nun?“ Die Lösung war verhältnismäßig einfach, Badeanzug an, alle anderen Sachen in einen der kleinen wasserdichten Seesäcke und dann stellte sich das größte der Probleme: wie kommt man auf den Steg und dann zwischen den dicht zusammenliegenden Booten hindurch, ohne anzuecken? Außerdem hatte ja der Bootsführer die Verpflichtung, die Mannschaft an Land zu bringen, ohne dass die Hälfte absoff und zwar die „bessere Hälfte“; über den tatsächlichen Ablauf wollen wir den Mantel des Schweigens breiten. Als das Schlimmste überstanden war, fand er sich mit einem Peekhaken auf dem Steg wieder, die „restlichen“ dreißig oder fünfzig Meter Brett für Brett abtastend, den festen Boden zu erobern, gefolgt vom Rest der Mannschaft. Auch der längste Steg, der gar nicht da war, geht mal zu Ende und mit festen Boden unter den Füßen lebt sich’s halt einfacher.
Nach dem Umziehen in den Waschräumen traf man sich draußen wieder. Die Damen auf See sind fast immer für Überraschungen gut, aber die Kapitänöse setzte noch einen drauf und erschien in aller Pracht und Schönheit vor der Tür mit ihrer angezogenen knallroten Rukka-Rettungsweste, die man schon drei Meilen gegen den Wind erkennen konnte über allen Klamotten. „Sie würde die Weste, - die im übrigen sehr weich und leicht ist – am heutigen Tage nicht mehr ablegen, komme, was wolle.“ Und das war so sicher, wie das Amen in der Kirche; jeder Protest zwecklos!
So begab man sich einträchtig geradewegs zur vorgenannten Bäckerei; eine andere gab es ja sowieso nicht. Von den wenigen Fußgängern, die man an diesem stürmischen Morgen traf, schaute der Eine mal etwas erstaunt, der Andere amüsiert, aber jeder sah zu, dass er möglichst schnell wieder von der Straße verschwand, damit er sich nicht irgendwo plötzlich im Graben wiederfand.
Die Bäckerrestauration war doch noch nicht offen und als man den nötigen Vorrat an Brötchen im Gepäck hatte, wurden auf kürzestem Wege die Räume der Kurverwaltung angesteuert, die bereits den Gästen zur Verfügung standen. Auch hier hielten sich die Besucherzahlen aufgrund des Wetters in Grenzen und man konnte sich in buchstäblich aller Ruhe dort ausbreiten, frühstücken und wie es in Neudeutsch heißt, relaxen.
Gegen Mittag, als dann der große Hunger sich so langsam durchsetzte, wurde die kleine Gaststätte in der Nähe der Tennisplätze aufgesucht, weil man nur dort die frischesten Fischgerichte, lecker zubereitet und vorgelegt, bekommen konnte. Auch hier mangelte es an Gästen und so wurde man, quasi wohl als kleine Entschädigung, richtig bemuttert, endlich mal. Als dann auch die große Pause mit Bier und Schoppen Wein vorüber war, hieß es zu überlegen: und wie nun weiter? Die Bordfrau wollte also vermeiden, noch eine weitere Nacht an Bord verbringen zu müssen, schließlich stürmte es immer noch, was das Zeug hielt; mit Durchschlafen war unter diesen Umständen nicht zu rechnen. Wenigstens einmal ruhig schlafen, war die Devise und man beschloss das nahegelegene Hotel aufzusuchen und um Unterkunft zu bitten.
Der Skipper wollte lieber an Bord schlafen, man weiß ja nie, was so alles passieren kann und wer kommt schon gern ohne Schiff wieder hjemme, also heim. Bei Nachfrage in der betreffenden Restauration erhielt man den Bescheid, es wäre noch ein kleines Zimmer frei. Geführt vom Kellner, begab man sich durch mehrere verwinkelte Gänge, bis eine Tür geöffnet wurde und der Bedienstete mit einer Handbewegung bedeutete etwa: „Voila, wir haben es erreicht.“
Erstaunter Blick der Bettbewerber, das Zimmer war so um die zwei Mal zweieinhalb Meter und dann die Frage: „Und wo, bitte schön, ist das Bett“ Erneute nonchalante Handbewegung des Gästebetreuers verbunden mit einem nahezu eleganten Griff an die Wand und dann, mit rasender Geschwindigkeit, kam das Bett aus der Wand geschossen, wurde ca. fünf Zentimeter vor dem Boden gestoppt und sehr sanft niedergelassen; auf jeder Möbelausstellung hätte er damit rasenden Beifall erhalten.
Die Schiffsbesatzung blickte sich einmal kurz an und der weibliche Teil nickte. Nun stand die Frage der Kosten im Raum, für eine Person und für eine Nacht und wurde prompt beantwortet: „Einhundertfünfunddreißig Deutsche Mark!“ Der Bettverkäufer stammte irgendwo aus dem südlichen Europa, das „Deutsche Mark“ rollte so richtig durch den Raum und man hatte das Gefühl, er möchte am liebsten dabei niederknien, so feierlich war sein Gesicht, was man vom Gesicht der Kapitänöse wahrlich nicht behaupten konnte. Es ähnelte wohl mehr dem der Medusa: „Wir hatten an sich nicht die Absicht, das Bett zu kaufen“, kam es sehr trocken, was der Zimmerbeauftragte mit einem erstaunten wohl mehr verständnislosen Lächeln beantwortete. Sie drehte sich auf der Stelle um und rauschte gleich einer kriegsbereiten Fregatte, sämtliche Geschützpforten offen, aus dem Raum. Sogar mit dem verwinkelten Gang schien sie keinerlei Schwierigkeiten zu haben, der Skipper hatte Mühe, sich im Kielwasser zu halten.
Und dann kam ihr großer Auftritt, bei ihrer doch respektablen Größe von fast 1,80 Meter konnte sie durchaus mit dem Geschäftsführer, auf den sie geradewegs zusteuerte und der so etwas unter 1,70 m maß, mithalten. Dieser blickte ihr erwartungsvoll entgegen, bis er die Mündungsfeuer in ihren Augen erkannte, da war es aber für eine Wende schon zu spät und er musste das Donnerwetter über sich ergehen lassen. „Mein Herr, was immer sie hier für einen Posten auszufüllen haben, ein guter Geschäftsmann sind sie mit ziemlicher Sicherheit nicht!“ Die erste Salve saß voll im Ziel, er hatte mindestens einen Mast verloren und so sah er auch aus; sicherlich hatte er ein anderes Ergebnis der Zimmerbesichtigung erwartet; sie ließ ihm jedenfalls keine Chance, irgendetwas zu entgegnen.
„Sie kennen uns seit Jahren, wir haben hier so oft gesessen und mit Freunden manchen Schoppen Wein geleert und dann unterbreiten Sie uns solch ein Angebot und das sozusagen in einem Notfall? Se werden uns und unsere Freunde in Ihrem Etablissement wohl kaum noch einmal begrüßen können, das verspreche ich Ihnen hier auf dieser Stelle!“ Damit drehte sie sich auf dem Punkt und „rauschte“ unter vollen Segeln aus dem Lokal. Immerhin saßen dort doch so einige Gäste und von „leise“ konnte bei ihrem Vortrag wohl kaum eine Rede gewesen sein. Der Geschäftsführer blieb mit hochrotem Kopf, verlegen lächelnd, am Tresen stehn, er war mittschiffs und unter der Wasserlinie voll getroffen, man sah es ihm an.
Danach war auch vom Angebot des Skippers, sich nach einem Zimmer im nahegelegenen Burg umzusehen, keine Rede mehr. „Sind wir über den Hund gekommen, kommen wir auch über den Schwanz“, ihr Ausspruch dazu, „Ich bleibe an Bord“ und damit hatte sich die Episode endgültig erledigt. Durch die allmähliche Winddrehung über Nord auf West war zwar das Hafenwasser etwas unruhiger geworden und der Sturm dröhnte und schrillte immer noch, wie gehabt, in der Luft, aber der Steg war wieder frei begehbar und man konnte gefahrlos ohne Schwierigkeiten an Bord kommen und sich auf eine einigermaßen angenehme Nacht einrichten. Alle Boote am Steg lagen fest, keine Leine hatte sich gelöst, so dass man von einer laufenden Kontrolle diese Nacht sicherlich absehen konnte.
Der Montagmorgen zeigte sich schon viel besser, die Sonne lugte ab und an durch die vorüber rasenden Wolkenfetzen und man beschloss, Dienstag die Heimreise anzutreten, wenn sich nichts weltbewegendes mehr ereignen würde, was es auch nicht tat.
Dienstag, der 31. August 1989 war dann der Tag der Abreise; bei strahlend blauem Himmel und erleichtertem Herzen verabschiedete man sich nicht ungern von der Insel Fehmarn. Draußen stand schon wieder eine mittlere See, diesmal von Westen und als die Hafeneinfahrt überwunden war und die weißen Tücher am Mast hingen und dem Schiff das Laufen beibrachten, fühlte sich jeder in seinem Element. Die Bordfrau am Ruder und der Skipper wieder schön in seiner Rukka-Rettungsweste verpackt sitzend auf dem Kajütdach, um erstmal einen guten Rundblick zu erhalten, das musste sein und der war von besonderer Art. Ab Großenbrode etwa veränderte sich die Farbe der See gravierend, vorher, wie gewohnt, noch wunderschön blau, ging sie über in ein graublau und je weiter man nach Süden segelte, nahm sie einen gelben Farbton an, dass man meinen musste, es wäre das Gelbe Meer, was man vor sich hatte und so ging das bis in die gesamte Lübecker bzw. Neustädter Bucht; die See musste Kopf gestanden haben.
Als das Boot dann Grömitz querab hatte, war der Heimathafen Neustadt nur noch einen Katzensprung entfernt und nach der Umrundung des Pelzer Hakens sah man endlich die große Ruhe vor sich. Nach dem Festmachen tauchte im Nachbarboot der „liebe Harald“ auf und meinte: „Du kannst Dir nicht vorstellen, was hier los gewesen ist, dauernd mussten wir die Boote losbinden und die Leinen verlängern und der Steg stand voll unter Wasser; wo hast du überhaupt gesteckt?“ „Oh, wir sind am Sonnabend von Dänemark rübergesegelt, so etwa bei Wind um die zehn bis elf Windstärken und haben dann auf Fehmarn festgelegen.“ Danach kam die große Pause, Harald hat dieses Wochenende später nie mehr angeschnitten.
Es besteht nun durchaus die Möglichkeit, dass sich der eine oder andere Leser fragt, warum wurde die Überfahrt, also das reine Segeln, nicht eingehender beschrieben, sondern mehr die landseitigen Erlebnisse, womit er durchaus nicht falsch liegt, aber hier sei gesagt, die Segelzeit war schon Horror genug und im Nachhinein hatten die Betroffenen kaum Möglichkeiten gehabt, die sich am laufenden Band abspielenden Krisensituationen permanent zu speichern. Jeder war wohl in seinem Leben schon in Lagen, wo er sich später fragte: wie ist es eigentlich dazu gekommen und wie lief das Ganze denn überhaupt ab? Im vorliegenden Falle reihten sich solche Momente sogar fast nahtlos aneinander, dass eine Riesenwelle plötzlich quer lief, der Großbaum sich ohne Erlaubnis in Bewegung setzte und unbedingt die Seite wechseln wollte oder der Wind direkt entgegengesetzt einfiel, womit man im Traum nicht rechnen konnte, es gab praktisch nichts, was es nicht gab. Der Kurs musste gehalten oder wieder aufgenommen werden, die Fahrt hatte im Schiff zu verbleiben. Alles andere war drittrangig, es handelte sich um einiges mehr als einen Sturm, das hatte man erkannt und das war zu bewältigen.
Die Hafenereignisse konnte man später wesentlich entspannter „genießen“ und sich wieder in Erinnerung bringen. Alles in allem, ein Orkan reicht für’s ganze Leben. An den Auswirkungen hätte man wohl auch nicht allzu viel ändern können, lediglich änderten von dieser Zeit an die Wetterstationen ihre Durchsagen und wohl auch Dienstzeiten. Es wurde nicht mehr Freitagmittag Schluss gemacht, seit diesem Desaster kann uns ein Orkan, der sich über Niedersachsen plötzlich bildete, dann nach Norden zog und überraschend nach Westen abbog und von dem niemand etwas ahnte, nicht mehr so leicht überraschen.
Fehmarn hatte ihn ganz gut überstanden; Kiel-Wentorf und andere Häfen kamen nicht so leicht davon; Schäden in Millionenhöhe waren das Ergebnis. In der Hauptsache wohl aufgrund gerissener Leinen und ähnlichem wurden zum Teil Nachbarboote regelrecht versenkt und sogar zerstört. Die Lübecker Bucht hatte in einigen Teilen Landunter und ganze Baumalleen verschwanden in den zwei Tagen und Nächten. Es war wohl der gesamte Küstenstreifen in irgendeiner Form von dieser Katastrophe betroffen und über Wochen und Monate mit Renovierungsmaßnahmen ausgelastet. Man kann nur hoffen, dass sich Überraschungen solcher Art künftig in Grenzen halten werden.